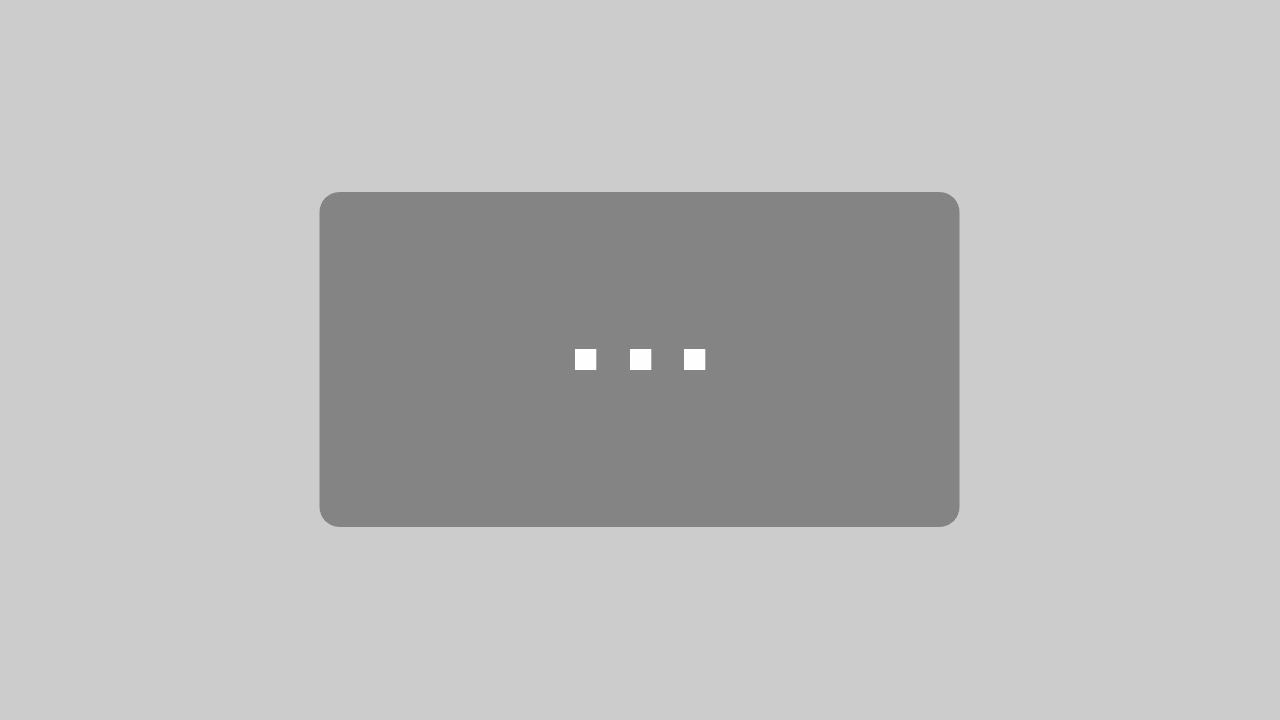Session #02
... 21 Prinzipien der wirksamen Interaktion mit Künstlicher Intelligenz ...
KI-Kickstart – 12.11.24 – Einordnung & Sonderfunktionen
Zusammenfassung des Coaching Calls
In diesem intensiven Trainingscall wurden verschiedene Funktionen und Techniken rund um KI-gestützte Tools und Anwendungen vorgestellt, die eine produktive Nutzung der KI im beruflichen Kontext ermöglichen.
1. Rückblick auf bisherige Inhalte und Tools
- Zunächst gab es eine kurze Zusammenfassung bisheriger Sessions. Hier wurden essentielle Tools wie ChatGPT, Perplexity, Claude und Just Record vorgestellt, die im Workflow nützlich sind. Ergänzend wurden Transkriptionstools wie Whisper und Übersetzungs- sowie Lektorat-Tools (DEEP L Write) thematisiert.
- Außerdem wurde das „Prompt-Engineering“ in sechs Stufen erklärt, um zu zeigen, wie präzise Fragestellungen und spezifische Kontextvorgaben zu besseren Ergebnissen bei der KI-Interaktion führen können.
2. Selbstverständnis und Schreibtonalität
- Eine zentrale Übung bestand darin, die eigene Schreib- und Ausdrucksweise sowie die persönliche Positionierung zu erarbeiten. Teilnehmer wurden dazu angeregt, ihre Rolle und Perspektive zu klären, um gezielt und authentisch mit der KI zu arbeiten.
- Der Hintergrund dieser Übung ist, Überforderung durch klare Zielsetzung und Anwendungsfokus zu reduzieren und so die Arbeit mit der KI produktiver zu gestalten. Ein „Prompt Repository“ wurde empfohlen, um häufig genutzte Eingaben und Textbausteine zentral zu speichern.
3. Überwältigung durch exponentielle Entwicklung der KI
- Es wurde auf das „Moore’sche Gesetz“ und die rapide Entwicklung der KI-Technologie hingewiesen, die alle drei Monate zur Verdopplung der Leistungsfähigkeit führt. Dies kann zu einem Gefühl der Überforderung führen.
- Um dieses Gefühl zu mindern, wurde ein Modell vorgestellt, das dabei hilft, die für einen selbst relevanten Anwendungsfälle zu identifizieren und sich auf diese zu konzentrieren. Hierbei ist ein „Bewusstseinskorridor“ hilfreich, der die Lücke zwischen KI-Möglichkeiten und den für die individuelle Anwendung relevanten Fällen schließt.
4. Praktische Übungen mit Bildern und Dokumenten
- Der Call beinhaltete eine Demonstration zur Bildgenerierung und -bearbeitung mithilfe von ChatGPT. Bilder können nun direkt in ChatGPT erstellt und in verschiedenen Stilen angepasst werden (z. B. Comic, Monet-Stil).
- Zusätzlich wurde die Möglichkeit besprochen, Bilder hochzuladen und von der KI analysieren zu lassen, um Details und Stimmungen im Bild zu erkennen. Dies kann auch zur Profilanalyse genutzt werden, wie zum Beispiel im Kontext von Persönlichkeitsprofilen (z. B. Insights-Modell).
- Eine weitere Übung bestand darin, die eigene Schreibtonalität basierend auf einem hochgeladenen Bild zu identifizieren und zu verfeinern.
5. Interaktion mit langen Texten und Transkriptionen
- Es wurde gezeigt, wie längere Dokumente und Transkripte (z. B. von Workshops oder Trainings) in ChatGPT verarbeitet und in einer strukturierten Form ausgegeben werden können. Das ermöglicht es, aus vorhandenen Inhalten schnell Buchkapitel, Zusammenfassungen oder Handouts zu erstellen.
- Über „Canvas“-Funktionalitäten konnte der Text flexibel überarbeitet und an verschiedene Zielgruppen (z. B. für eine bestimmte Altersstufe) angepasst werden.
6. Empfohlene Implementierungsaufgaben
- Die Teilnehmer wurden aufgefordert, ein eigenes Bild hochzuladen und mithilfe der KI zu analysieren, um Hinweise zur eigenen Schreibtonalität zu gewinnen.
- Sie sollten ebenfalls ein Textbild oder eine Positionierung von sich erstellen und daraus eine visuelle Darstellung erzeugen.
- Abschließend wurde die Nutzung von hochgeladenen Dokumenten empfohlen, um die Fähigkeit der KI zu erproben, aus komplexen Inhalten gezielte Informationen herauszufiltern.
Dieser Call bot eine praxisnahe Anleitung und umfassende Inspiration, wie die Teilnehmer die KI in ihrer Arbeit produktiv einsetzen können und gleichzeitig ihre eigene Positionierung und Schreibtunalität schärfen. Die vermittelten Konzepte und Übungen sollen dazu beitragen, effizienter zu arbeiten und ein Gefühl der Überforderung durch gezielten Fokus zu minimieren.
Q&A – 12. November 2024
Aufzeichnung – Kontext – 15. November 2024
Zusammenfassung des Trainingscalls
Inhalte und Highlights des Calls:
- Einleitung und Rahmenbedingungen:
- Der Call war in ein interaktives Lernformat eingebettet, unterstützt durch Teilnehmende des Basecamp-Workshops „Master Facilitator“.
- Es wurde demonstriert, wie Workshop-Teilnehmende von verschiedenen Perspektiven lernen können, darunter auch aus der Sicht der Teilnehmenden selbst.
- Hauptthema: Geleitwort-Erstellung mit KI – Ein Praxisbeispiel:
- Kontext und Ziel:
- Die Aufgabe bestand darin, ein Geleitwort für ein Buch eines renommierten Autors zu schreiben.
- Der Fokus lag darauf, die KI effektiv für eine hochwertige, emotionale und prägnante Textproduktion zu nutzen.
- Prozessschritte zur Erstellung:
- Prüffrage: Zunächst wurde die KI gefragt, ob sie mit dem Begriff „Geleitwort“ vertraut ist.
- Strukturerarbeitung: Die KI wurde gebeten, die grundsätzliche Struktur eines Geleitwortes zu definieren. Diese bestand aus:
- Einleitung
- Würdigung des Autors
- Relevanz des Buches
- Einordnung des Werkes
- Motivierende Einladung
- Abschluss
- Kontextbereitstellung:
- Persönliche Informationen (Biografie und Positionierung des Geleitwort-Autors).
- Details über den Autor (z. B. LinkedIn-Profil, Publikationen) und Inhalte des Buches (PDF hochgeladen).
- Präzise Vorgaben zu Tonalität und Tabuwörtern (z. B. keine inflationären Begriffe wie „entdecken“ oder „umarmen“).
- Finaler Prompt: Ein einziger, umfassender Befehl wurde an die KI formuliert, um die Informationen zu einem fertigen Geleitwort zusammenzuführen.
- Ergebnis: Die KI lieferte einen emotional ansprechenden, professionellen Text, der bei den Teilnehmenden Begeisterung und Gänsehaut auslöste.
- Kontext und Ziel:
- Vertiefung: Prinzipien der wirksamen KI-Interaktion:
- Die Erstellung des Geleitwortes basierte auf den 21 Prinzipien der KI-Interaktion, darunter:
- Perspektive und Rolle: Klare Definition der Perspektive (z. B. Schreibender und Buchautor).
- Kontext als Schlüssel: Vollständige und präzise Bereitstellung aller relevanten Informationen.
- Erwartungen und Tabus: Klare Vorgaben zu Tonalität, Länge, Stil und zu vermeidenden Begriffen.
- Interaktionsschritte: Aufbau des Ergebnisses durch gezielte Prüffragen und strukturierte Arbeitsschritte.
- Die Erstellung des Geleitwortes basierte auf den 21 Prinzipien der KI-Interaktion, darunter:
- Wichtige Erkenntnisse:
- Die KI kann emotional ansprechende und hochprofessionelle Texte erstellen, wenn die Eingaben klar und gut durchdacht sind.
- Anpassungen am finalen Text sollten nicht in der KI, sondern manuell erfolgen, um ein persönliches Feintuning zu gewährleisten.
- Es wurde hervorgehoben, dass die richtige Anwendung der KI-Kommunikationstechniken (Shit in, Shit out) entscheidend für die Qualität des Outputs ist.
- Hausaufgabe/Implementierungsaufgabe:
- Aufgabe: Teilnehmende sollen ein Geleitwort für ein beliebiges PDF-Dokument schreiben, z. B. für eine Produktbeschreibung oder ein Fachartikel.
- Ziel ist es, die im Call vorgestellten Prinzipien praktisch anzuwenden und den Transfer in den eigenen Arbeitsalltag zu üben.
- Weitere Inhalte und Ausblick:
- Kommende Sessions:
- Weitere Praxisbeispiele zur Anwendung der 21 Prinzipien, z. B. Umwandlung von Podcasts in Show Notes oder LinkedIn-Beiträge.
- Einführung in die 21 Prinzipien der wirksamen Interaktion mit KI, die als zentraler Leitfaden für alle Anwendungsfälle dienen.
- Die Teilnehmenden wurden ermutigt, weiter mit der KI zu experimentieren, Fragen zu stellen und eigene Anwendungsfälle einzubringen.
- Kommende Sessions:
Stimmung und Feedback:
- Die Teilnehmenden waren begeistert, inspiriert und motiviert, die vorgestellten Techniken anzuwenden.
- Viele lobten die Klarheit und die Praxisnähe des Calls sowie die beeindruckenden Ergebnisse der KI-Arbeit.
Dieser Call hat eindrucksvoll gezeigt, wie durch gezielte und strukturierte Interaktion mit der KI kreative und hochwertige Ergebnisse erzielt werden können. Die vermittelten Prinzipien bieten eine solide Grundlage für den Umgang mit KI im beruflichen Kontext.
Aufzeichnung – Q&A – 15. November 2024
Zusammenfassung der gestellten Fragen und Antworten aus dem Q&A Call:
Frage 1:
„Bei drei Versuchen zur Positionierung ergaben sich etwas unterschiedliche Texte. Würdest du sie selber zusammenfügen? Ich habe das in ChatGPT probiert, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Wie könnte ich das machen?“
Antwort:
- Das Wahrscheinlichkeitsprinzip der KI führt dazu, dass die Antworten variieren können.
- Empfehlung: Die drei Ergebnisse sollten in einem neuen Prompt zusammengeführt werden, wobei eine klare Struktur mitgegeben wird. Beispiel: „Füge die folgenden drei Ergebnisse gemäß der Struktur (z. B. Positionierungsbausteine) zusammen.“
- Wichtige Bausteine oder Tabus sollten explizit angegeben werden, wie z. B. Wörter, die vermieden werden sollen, oder die gewünschte Schreibtonalität und Länge.
- Das gibt der KI eine klare Orientierung und verbessert die Qualität des Ergebnisses.
Frage 2:
„Ich habe eine einfache Frage: Wenn ich ein Bild generiere, bekomme ich immer nur ein Bild und keine vier oder sechs Vorschläge wie bei anderen. Kann man das irgendwie triggern?“
Antwort:
- Die KI generiert mehrere Bilder automatisch, wenn der Prompt auf eine umfassende Darstellung abzielt (z. B. „Erstelle eine visuelle Reise mit mehreren Szenen“).
- Wenn mehrere Bilder benötigt werden, sollte explizit angegeben werden, wie viele Variationen gewünscht sind.
- In dem Beispiel wurde gezeigt, wie man eine größere Anzahl von Bildern anfordert, aber auch, dass der Erfolg vom Prompt und Kontext abhängt.
- Einfach ausprobieren und mit präziseren Angaben experimentieren.
Frage 3:
„Wie gehe ich vor, wenn ich für unterschiedliche Kunden arbeite, die jeweils eine andere Positionierung und Tonalität haben? Kann sich ChatGPT das merken?“
Antwort:
- Arbeiten mit frischen Chats: Für jeden Kunden oder jedes Projekt sollte ein neuer Chat geöffnet werden. So bleibt der Kontext sauber und die Ergebnisse sind präziser.
- Die Persönlichkeitseinstellungen von ChatGPT (z. B. im Profil) werden nicht genutzt, da dies die Flexibilität bei der Arbeit mit verschiedenen Kunden einschränken würde.
- Im neuen Chat sollte die Perspektive des Kunden klar definiert werden: „Ich bin [z. B. Pressesprecherin von Kunde X] und benötige Inhalte für …“. So kann die KI spezifisch und zielgerichtet arbeiten.
- Wenn Inhalte weiterentwickelt werden, sollte auf bestehende Chats zurückgegriffen werden, um den vorhandenen Kontext zu nutzen. Neue Inhalte werden hingegen immer in einem neuen Chat begonnen.
Frage 4:
„Ich bin dabei, ein Kinderbuch fertigzustellen und möchte die Fantasiefiguren von der KI zeichnen lassen. Wie bekomme ich diese Zeichnungen in meine Word-Dokumente, und wie optimiere ich das Format für Social Media?“
Antwort:
- Bilder können direkt kopiert und in Word eingefügt werden. Hier sollte auf das richtige Format (PNG oder JPEG) und ggf. transparente Hintergründe geachtet werden.
- Wenn die Auflösung nicht ausreichend ist, können Tools wie MidJourney oder Upscaling-Software verwendet werden, um hochauflösende Bilder zu generieren.
- Für einheitliche Charaktere empfiehlt es sich, einen festen Prompt zu entwickeln, der Farben, Stil und Details konsistent hält.
- Die Nutzung von Tools wie MidJourney für komplexere Designs wurde besonders empfohlen.
Frage 5:
„Kann sich ChatGPT dauerhaft merken, wie ein Kunde oder Projekt heißt, und den Kontext automatisch aufgreifen?“
Antwort:
- ChatGPT speichert keine Informationen dauerhaft zwischen den Sitzungen.
- Kontext für jeden neuen Chat muss jedes Mal erneut angegeben werden (z. B. „Ich bin XY, schreibe für Kunde Z“).
- Wichtige Details sollten immer direkt im Chat geklärt und spezifiziert werden. Es ist hilfreich, wichtige Daten wie Namen oder Schreibweisen selbst im Auge zu behalten.
Zusatzfrage zu Bildern und Formaten:
„Wenn ich Social-Media-Bilder generieren lasse, sagt Facebook oft, dass das Format nicht passt. Wie löse ich das Problem?“
Antwort:
- Die Auflösung und das Seitenverhältnis müssen explizit im Prompt definiert werden, z. B. „Erstelle ein Bild im Format 1080 x 1080 Pixel für Social Media.“
- Hochauflösende Formate (z. B. 4K) sollten bei Bedarf zusätzlich über ein Bildbearbeitungstool skaliert werden, da KI-generierte Bilder oft nicht automatisch optimiert sind.
- Community-Tipp: Fragen zu spezifischen Hacks können in der KI Lounge gestellt werden, wo andere Nutzer mit Erfahrung in der Bildbearbeitung helfen können.
Das waren die wesentlichen Fragen und Impulse des Calls. Die Themen waren vielseitig und reichten von praktischen KI-Anwendungen bis hin zu strategischen Tipps. Weitere Details und Hintergründe sind im vollständigen Video nachzuverfolgen.
Q&A – 15. November 2024
Auswertung des Q&A Calls
Hier sind die Fragen und die jeweiligen Kernantworten aus dem Call zusammengefasst:
Fragen und Antworten aus dem Call:
1. Frage (Beate):
„Bei drei Versuchen zur Positionierung ergaben sich unterschiedliche Texte. Würdest du sie selbst zusammenfügen? Wie könnte ich das machen?“
Antwort:
- Wichtig ist, dass die Struktur für die gewünschte Positionierung klar definiert ist.
- Vorschlag: Im Prompt deutlich machen, welche Bausteine (z. B. sechs Bausteine für die Positionierung) eingebunden werden sollen.
- So könnte ein Beispiel-Prompt aussehen: „Ich habe hier drei Ergebnisse (Ergebnis 1, 2 und 3). Füge sie in ein Gesamtergebnis zusammen, welches der folgenden Struktur folgt: [Strukturbeschreibung].“
- Zusätzliche Empfehlungen können gegeben werden, wie z. B. Wörter, die vermieden werden sollen, oder die gewünschte Tonalität und Textlänge.
- Der Ansatz hilft, KI-Antworten gezielt zu steuern und die Struktur zu wahren.
2. Frage (Amy):
„Wenn ich ein Bild generiere, bekomme ich immer nur eins. Kann man auch mehrere Varianten, wie z. B. vier oder sechs Bilder, gleichzeitig generieren?“
Antwort:
- Der Split-Screen mit mehreren Bildern entsteht meist, wenn ein allgemeiner, kontextreicher Prompt verwendet wird, der auf eine Reise oder ein Thema Bezug nimmt.
- Um mehrere Vorschläge zu erhalten, sollte der Prompt spezifisch darauf hinweisen, z. B.: „Generiere vier Varianten dieses Bildes.“
- Beispiel: „Erstelle mir ein Fotobild im 16:9-Format, das die Reise fotorealistisch darstellt.“
- Wenn KI nur ein Bild liefert, kann das Kontextfenster oder die Anzahl der gewünschten Bilder explizit im Prompt angegeben werden.
3. Frage (Valérie):
„Wie gehe ich mit mehreren Kunden um, die unterschiedliche Positionierungen und Tonalitäten haben? Wie organisiere ich Threads sinnvoll?“
Antwort:
- Immer mit frischen Chats für jeden neuen Kunden oder jedes neue Projekt arbeiten, um den Kontext klar abzugrenzen.
- Kontext im neuen Chat klar einführen: Wer ist der Kunde? Welche Tonalität wird benötigt? Welche Perspektive soll eingenommen werden?
- Ein Beispiel: „Ich bin [Rolle] für [Kunde A]. Schreibe einen Social Media Post, der die Positionierung und Tonalität dieses Kunden widerspiegelt.“
- Bestehende Chats können genutzt werden, wenn es um die Fortsetzung eines Themas geht (z. B. bei vorherigen Diskussionen oder Texten), aber grundsätzlich ist ein sauberer Neustart besser.
- Inhalte und Vorgaben nicht in den KI-Persönlichkeitseinstellungen speichern, sondern direkt im Chat einführen.
4. Frage (Biene):
„Wie kann ich KI-generierte Zeichnungen (z. B. für ein Kinderbuch) in Word-Dokumente einfügen, ohne Probleme mit Qualität oder Format zu bekommen?“
Antwort:
- Einfacher Weg: Bilder in hoher Auflösung generieren (z. B. in MidJourney oder Dolly), dann per „Kopieren und Einfügen“ oder als PNG-Datei in Word integrieren.
- Sicherstellen, dass das Bildformat (z. B. 16:9) und die Auflösung für den Druck geeignet sind.
- Für konsistente Charaktere: In Tools wie MidJourney können Stile und Eigenschaften von Figuren in Prompts definiert und abgespeichert werden, um sie später wiederzuverwenden.
- Wenn Bildqualität oder Auflösung nicht ausreichen, können externe Bildbearbeitungstools wie Upscaling-Programme genutzt werden.
- Tipp: In der KI Lounge nachfragen, falls weiterführende Unterstützung benötigt wird.
Zusätzliche Erkenntnisse aus dem Call:
- Künstliche Intelligenz arbeitet probabilistisch: Ergebnisse sind nie identisch und können unterschiedlich ausfallen. Um konsistente Antworten zu erzielen, hilft ein präziser und strukturierter Prompt.
- Frische Chats bevorzugen: Jeder Chat sollte möglichst neu und kontextbezogen gestartet werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Flexibilität in der Bildnutzung: Je nach Tool und Anforderung können Text-, Bild- oder Kontextvorgaben individuell angepasst werden.
- Fortsetzung vorhandener Themen: Bestehende Threads nur dann weiterführen, wenn der gesamte Kontext relevant bleibt. Andernfalls ist ein Neustart sinnvoller.
Abschluss des Calls:
Der Call endete mit einer Verabschiedung und dem Hinweis, dass die Aufzeichnung des Calls bald in der Online-Akademie verfügbar sein wird. Teilnehmer wurden dazu ermuntert, weiter Fragen zu stellen und sich aktiv in den Chat einzubringen.