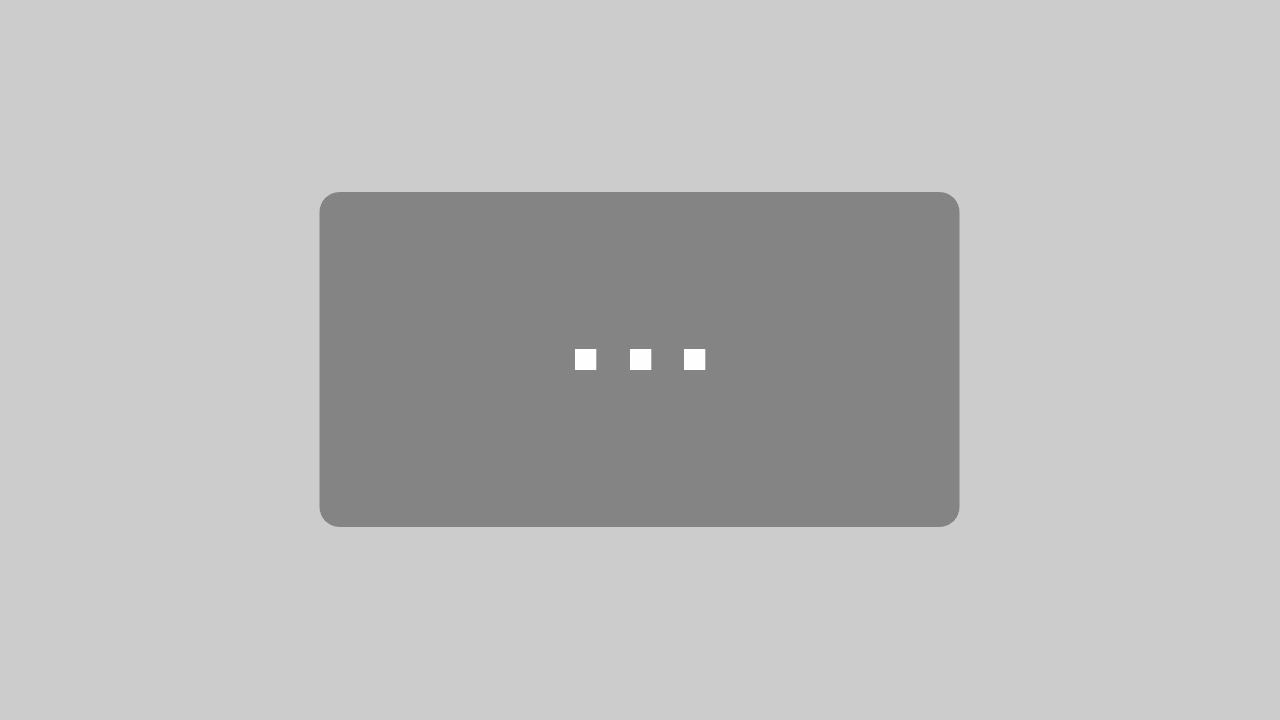Die TAKTISCHE Ebene
- Bewertung von AWFs mit Stakeholder-Gruppen - 26.06.2025
- Bewertung & Optimierung von AWFs - 24.06.2025
- KI-Triggerkarten in Workshops - 12.06.2025
- Strategie zu Anwendungsfall - 05.06.2025
- Customer Journey - 15.05.2025
- Produktmodellierung - 13.05.2025
- Prozessoptimierung - 08.05.2025
- Anwendungsfälle - 06.05.2025
- Überblick - 29.04.2025
Bewertung & Optimierung von Anwendungsfällen mit breiten Stakeholder-Gruppen – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 26.06.2025
DOWNLOADS
Zusammenfassung des Trainingscalls
In diesem Trainingscall standen zwei zentrale Themen im Fokus:
- Erfahrungsbericht von Thomas: Erfolgreiche Akquise und Planung eines ersten AI Design Sprint Workshops
Thomas berichtet von der erfolgreichen Platzierung seines ersten KI-basierten Design Sprint Workshops. Ausgangspunkt war eine Empfehlung durch einen bestehenden Kunden aus der Energiebranche, konkret ein Stromnetzbetreiber aus NRW. Trotz anfänglicher Skepsis seitens der Ansprechpartnerin entwickelte sich durch einen Discovery Call Neugierde und Offenheit gegenüber dem Thema Künstliche Intelligenz.
Wesentliche Schritte und Inhalte:
- Nach dem Discovery Call erstellte Thomas mithilfe KI-gestützter Tools ein überzeugendes Workshop-Angebot samt Skizze.
- Der Workshop soll das Projektmanagement im Leitungsbau mithilfe von KI unterstützen und potenzielle Use Cases identifizieren.
- Die Workshop-Struktur umfasst:
- Einführung in KI und Sensibilisierung (basierend auf dem KI-Innovationsrahmen)
- Nutzung von Elementen aus dem AI Design Sprint (z. B. Concept Development, AI Trigger Karten)
- Optional: Tech Check und Prototyping (2 bzw. max. 5 Tage)
- Ziel: ein Vor-Ort-Workshop mit 8 Teilnehmenden – eine Premiere für Thomas in diesem Format.
- Thomas erhält den Zuschlag, muss jedoch formal auf ein Trainingsangebot umschwenken, da keine klassische Beratungsleistung ohne interne Freigabe beauftragt werden darf.
Diskussion zu Preisgestaltung und Angebotsstruktur:
- Der Workshop wurde für 5.500 € angeboten.
- Die Gruppe reflektierte in einer interaktiven Übung mögliche Preispunkte für Workshop, Tech Check und Prototyping. Vorschläge lagen teils deutlich höher.
- Axel stellte ein Modell zur Preisfindung vor (1.850 € pro Teilnehmer).
- Diskussion über Paketierung (S-, M-, XL-Angebote) und wie Zusatzleistungen wie Vor- und Nachbereitung sowie Interviews den Wert des Angebots erhöhen und den Zeit-für-Geld-Aspekt maskieren können.
- Empfehlung: Leistungsbausteine klar benennen und als Produkt mit Mehrwert kommunizieren, um Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten zu reduzieren.
- Thema: erfolgsbasierte Vergütungsmodelle – insbesondere bei quantifizierbarem Mehrwert (z. B. Einsparung von Agenturkosten durch einen KI-Telefonbot).
- Auswahl und Bewertung von Anwendungsfällen mit breiten Stakeholder-Gruppen
In der zweiten Hälfte wurde eine methodische Herangehensweise demonstriert, wie man mit größeren Gruppen strategisch über die Auswahl von KI-Anwendungsfällen entscheidet.
Vorgehen:
- Nutzung eines vorbereiteten Miro-Boards mit vier anonymisierten Anwendungsfällen.
- In Breakout-Sessions wurden die Anwendungsfälle zunächst beschrieben, dann reflektiert und bewertet.
- Bewertungskriterien umfassten: Mehrwert, Reifegrad, Machbarkeit, positive Auswirkungen, potenzielle Herausforderungen.
- Bewertung über ein Punktesystem auf dem Miro-Board durch alle Teilnehmenden.
- Ziel: auf objektive Weise die relevantesten Anwendungsfälle mit dem größten strategischen Potenzial zu identifizieren.
- Ergebnis: zwei Anwendungsfälle stachen hervor – ein strukturierter Datenkonsolidierungsprozess („Daten in einem Ordner“) und ein KI-gestützter Telefonbot.
- Daraus ergibt sich ein klarer Entscheidungsweg: Die am höchsten bewerteten Anwendungsfälle gehen in die nächste Phase – Business Case Entwicklung und Entscheidungsvorlage.
Empfehlung für die Umsetzung:
- Die Methode eignet sich besonders bei komplexen Stakeholderkonstellationen und Anwendungsfällen mit größerem Umsetzungsvolumen.
- Die systematische Bewertung reduziert Diskussionen über Prioritäten und macht Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und transparent.
- Die dokumentierten Ergebnisse können direkt in die Business Case Ausarbeitung und die Kommunikation mit der Geschäftsleitung einfließen.
Fazit:
Ein praxisnaher Call, der sowohl individuelle Lernerfolge als auch methodische Ansätze zur Auswahl und Strukturierung von KI-Initiativen vereinte. Besonders wertvoll war die transparente Diskussion über Preisgestaltung, Angebotsstruktur und strategische Kundenkommunikation. Der Live-Einblick in die Bewertungsmethodik auf dem Miro-Board lieferte zudem ein sofort anwendbares Werkzeug für zukünftige KI-Projekte mit komplexer Entscheidungsstruktur.
Bewertung & Optimierung von Anwendungsfällen – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 24.06.2025
DOWNLOADS
Zusammenfassung Trainingscall:
In diesem Trainingscall wird ein strukturierter, kollaborativer Bewertungsprozess vorgestellt, mit dem Teams komplexere oder abteilungsübergreifende Anwendungsfälle gezielt reflektieren, erweitern und priorisieren können. Ziel ist es, auf Basis einer fundierten Entscheidungsgrundlage – etwa eines Mini-Business-Cases – Klarheit darüber zu gewinnen, welche Use Cases weiterverfolgt und ggf. budgetär freigegeben werden sollen.
Zentrale Inhalte des Calls:
- Einführung & Zielsetzung
- Vorschau auf den kommenden Donnerstagstermin: Dort soll der vorgestellte Bewertungsprozess gemeinsam an 2–3 konkreten Anwendungsfällen exemplarisch durchgespielt werden.
- Bisher wurde mit der Aufwand-Nutzen-Matrix gearbeitet, um Anwendungsfälle zu identifizieren und herunterzubrechen.
- Erweiterter Entscheidungsprozess bei komplexeren Use Cases
- Wenn Anwendungsfälle komplexer oder organisationsübergreifend sind (z. B. Marketing, Einkauf, Geschäftsführung involviert), reicht die einfache Matrix nicht aus.
- In solchen Fällen ist eine tiefergehende Reflexion notwendig, bevor Ressourcen investiert werden.
- Dazu dient eine strukturierte Vorlage für einen Mini-Business-Case bzw. eine Entscheidungsvorlage.
- Kollaborativer Bewertungsprozess in vier Schritten
- Die Teilnehmer arbeiten mit physischen Boards (schwarze Pappen), auf denen die Use Cases dokumentiert und diskutiert werden.
- Die Pappen werden in mehreren Runden im Team bearbeitet, um Perspektiven zu integrieren und ein gemeinsames Verständnis zu fördern.
Vier Bausteine im Detail:
Anwendungsfallbeschreibung:
-
-
- Aus vorhandenen Templates übertragbar.
- Ziel: Klarheit schaffen über Ausgangslage und Zielsetzung.
-
Reflexion & Ergänzung:
-
-
- Fragen zur Verbesserung des Use Cases, unabhängig von KI-Technologie.
- Identifikation von Bereichen, in denen KI unterstützen kann.
- Jeder Teilnehmer bringt Ideen und Hinweise ein.
-
Kritische Reflexion (Vor- und Nachteile):
-
-
- Positive Aspekte des Use Cases werden gesammelt (z. B. strategische Relevanz).
- Nachteile werden nicht pauschal benannt, sondern in Form konstruktiver Fragen formuliert, um Lösungsansätze zu ermöglichen.
Beispiel: Statt „Die Datenqualität ist schlecht“ → „Wie können wir die Datenbasis im CRM verbessern?“
-
Bewertung anhand definierter Kriterien:
-
-
- Kriterien stammen aus dem Innovationsrahmen (z. B. Reduktion manueller Aufwände, Datenqualität, Kundenzufriedenheit).
- Jeder vergibt Punkte (z. B. durch Klebepunkte) zu den jeweiligen Kriterien.
- So entsteht eine objektivierte, konsensbasierte Gesamtbewertung.
-
- Ergebnis des Prozesses
- Sichtbare Bewertung auf dem Board mit Gesamtscore.
- Vergleichbarkeit der Use Cases durch standardisierten Bewertungsmechanismus.
- Auswahl der besten Anwendungsfälle zur Weiterverfolgung (z. B. 5 von 12).
- Integration in den Implementierungsprozess
- Der Prozess kann direkt auf eigene Use Cases angewendet werden.
- Teilnehmer erhalten die Aufgabe, zwei bis drei relevante Anwendungsfälle auszuwählen, um den Prozess am Donnerstag praktisch zu testen.
- Ziel: Identifikation der Use Cases mit dem größten Potenzial für einen Business-Case.
- Organisatorisches & Ausblick
- Abstimmung zur Rolle der Moderation für den Donnerstagstermin.
- Hinweise zum Starter-Kit mit physischen Karten, die für den Prozess zur Verfügung gestellt werden.
- Informationen zur Teilnahme an der Veranstaltung „KI Connect“ (inkl. Zeitslots und Ablauf).
- Vorstellung des finalen Starter-Kits inklusive physischer Materialien, die bereits eingetroffen sind.
Fazit:
Der Call stellt einen nachvollziehbaren, praxisorientierten Bewertungsprozess vor, mit dem Anwendungsfälle für KI fundiert analysiert, weiterentwickelt und priorisiert werden können. Er schafft Beteiligung, Transparenz und eine objektivierte Entscheidungsbasis – insbesondere bei komplexen Szenarien. Die Methode wird am Folgetermin gemeinsam erprobt.
KI-Triggerkarten in Workshops – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 12.06.2025
Titel: KI-Triggerkarten wirksam einsetzen – Anwendung, Reflexion & Best Practices
Zielgruppe: Absolventinnen und Absolventen des AI Design Sprint Facilitator Trainings
Format: Interaktiver Praxis-Workshop mit Reflexion, kollegialem Austausch und Fallarbeit
Ziel des Workshops
Der Workshop diente der Vertiefung des Verständnisses sowie der praktischen Anwendung der KI-Triggerkarten im Kontext von Design Sprints und strategischen Kundenworkshops. Ziel war es, Klarheit über Sinn, Aufbau und Einsatzmöglichkeiten der Karten zu schaffen und ihre Wirksamkeit im Workshopdesign zu erproben.
Einstieg: Was ist wirklich verstanden worden?
- Ehrliche Selbstreflexion der Teilnehmenden: Wer hat das Prinzip der Karten tatsächlich durchdrungen?
- Viele berichten, dass sie erst in der Anwendung oder bei der Vorbereitung auf Kundenworkshops ein tieferes Verständnis entwickelt haben.
- Gemeinsames Fazit: Die Karten bieten einen guten Impuls, benötigen aber klare Moderation und Kontext, um wirksam eingesetzt zu werden.
Diskussion und Kritikpunkte an den Triggerkarten
Positiv bewertet:
- Vereinfachter Zugang zu generativer KI, auch ohne technisches Vorwissen
- Förderung von Diskussion und Perspektivwechsel
- Visuelle und haptische Impulse unterstützen das Verständnis
Kritische Aspekte:
- Aktualität der Beispiele (z. B. Unternehmensreferenzen)
- Teilweise unklare Logik und Reihenfolge
- Gefahr der Überforderung ohne klare Struktur und Anleitung
- Karten allein reichen nicht – Moderation ist entscheidend
Verbesserungsvorschläge:
- Nutzung von Moderationskarten zur Begleitung
- Bessere Strukturierung in Themenblöcke (z. B. übergeordnet und abgeleitet)
- Feedback-Rückfluss an die Entwickler:innen wie Mike Brandt sinnvoll
Mini-Living-Case: Workshop übernehmen – was brauche ich?
Ein realistisches Szenario wurde simuliert: Ein Facilitator fällt krankheitsbedingt aus, andere springen kurzfristig ein.
Zentrale Aspekte:
- Welche Fragen sind entscheidend, um den Workshop sinnvoll zu übernehmen?
- Wie lässt sich der Einsatz der Triggerkarten in ein sauberes Workshopdesign integrieren?
- Was ist bei der Zieldefinition, Teilnehmerstruktur, Vorbereitung und Materialeinsatz zu beachten?
Ergebnis:
- Gute Vorbereitung (z. B. via Miro) ist essenziell, gerade für hybride oder verteilte Formate
- Kartenstruktur, Zielklarheit und partizipative Elemente sichern Wirkung und Transfer
- Der Einsatz richtet sich stark nach dem jeweiligen Reifegrad des Kunden (Stichwort: Räume der Veränderung)
Best Practices und Learnings zum Einsatz der Triggerkarten
- Einstieg in generative KI schaffen
Die Triggerkarten bieten eine niedrigschwellige Möglichkeit, erste Berührungspunkte mit KI zu schaffen – ohne Tool-Fokus oder Technikwissen. - Gemeinsame Sprache etablieren
Die Karten ermöglichen eine gemeinsame Gesprächsbasis zwischen heterogenen Zielgruppen (IT, HR, Management etc.). - Kontext und Führung sind entscheidend
Die Wirkung der Karten hängt maßgeblich davon ab, wie sie inhaltlich eingebettet und methodisch moderiert werden. - Physisch oder digital – der Kontext entscheidet
- Physische Karten sind greifbar, fördern Interaktion, erfordern aber Logistik
- Digitale Umsetzung via Miro ermöglicht effiziente Dokumentation, Nachnutzung und auch hybride Formate
- Perspektivwechsel initiieren
Der Kernwert der Karten liegt nicht in Vollständigkeit oder Systematik, sondern in der Inspiration und Denköffnung. Ziel ist, neue Anwendungsfelder zu erkennen und Transferimpulse zu erzeugen.
Fazit
Der Workshop bot einen tiefen Einblick in die Anwendung der KI-Triggerkarten. Die Teilnehmenden reflektierten offen über eigene Lernerfahrungen und identifizierten zentrale Erfolgsfaktoren für die Umsetzung im Kundenkontext. Die vorgestellte Miro-Struktur sowie die Anwendung im Mini-Case-Szenario gaben praxisnahe Orientierung für den eigenen Einsatz.
Empfehlung: Bei der Arbeit mit den Karten sollte immer bedacht werden, in welchem Veränderungsraum sich die Zielgruppe befindet. Auf dieser Basis lassen sich Inhalte gezielt auswählen, methodisch sinnvoll moderieren und zu wirksamen Ergebnissen führen.
Strategie zu Anwendungsfall – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 05.06.2025
In diesem Trainingscall wurde ein umfassender methodischer Rahmen vermittelt, wie aus einer Vielzahl identifizierter Anwendungsfälle gezielt diejenigen ausgewählt und ausgearbeitet werden, die das höchste Wirkungspotenzial für Kunden und Organisation entfalten. Die Inhalte verbinden strategisches Denken, praktische Moderationserfahrung und technische Relevanz insbesondere im Kontext KI-gestützter Projekte.
- Von der taktischen Analyse zur ersten Auswahl
Ausgangspunkt ist die Identifikation potenzieller Anwendungsfälle entlang von Prozessen, Produkten, Dienstleistungen oder Customer Journeys. Ziel ist es, auf Basis von Reflexionen und Analysewerkzeugen wie dem „Ich will damit“-Prozess eine strukturierte Sammlung an Use Cases zu erheben – oftmals in dreistelliger Anzahl.
Diese werden dann im ersten Schritt durch eine Aufwand-Nutzen-Matrix priorisiert – idealerweise abgestimmt auf den sogenannten Innovationsrahmen, der die strategischen Leitplanken des Kundenprojekts bildet. Nur Anwendungsfälle, die diesen Vorgaben entsprechen, kommen in die engere Auswahl.
- Die Nutzenformel als Entscheidungskompass
Der wahrgenommene Nutzen eines Anwendungsfalls – und damit seine Realisierungschance – hängt von vier entscheidenden Parametern ab:
- Zielerreichung: Wird das vom Kunden gewünschte Ergebnis zuverlässig erreicht – auf eine für ihn stimmige Weise?
- Eintrittswahrscheinlichkeit: Wie sicher ist es, dass dieses Ergebnis auch tatsächlich eintritt?
- Reibungsverluste und Aufwand: Wie viel Mühe, Verzicht und Aufwand hat der Kunde im Verlauf der Zusammenarbeit?
- Dauer bis zum Ergebnis: Wie schnell kann das Ziel erreicht werden?
Je stärker ein Anwendungsfall diese vier Variablen positiv beeinflusst, desto höher ist der wahrgenommene Nutzen – und somit die Investitionsbereitschaft des Kunden.
- Die Rolle der KI als Nutzenverstärker
Künstliche Intelligenz fungiert als Hebel in allen vier Bereichen:
- Sie erhöht die Eintrittswahrscheinlichkeit durch Reproduzierbarkeit.
- Sie reduziert Aufwand und Reibungsverluste auf Kunden- und Dienstleisterseite.
- Sie verkürzt die Dauer bis zur Zielerreichung signifikant.
- Sie macht ambitionierte Ziele realistischer – bis hin zu vollautomatisierten Systemen.
Konkrete Beispiele aus Projekten zeigen, wie KI bereits heute zentrale Prozesse effizienter und wirkungsvoller gestaltet.
- Priorisierung durch Aufwand-Nutzen-Matrix und Innovationsfit
In einem strukturierten Workshop-Setting werden Anwendungsfälle durch alle Beteiligten gemeinsam priorisiert – etwa durch Punktevergabe auf einer Aufwand-Nutzen-Matrix. Maßgeblich ist, dass jeder Fall dem strategischen Zielbild (Innovationsrahmen) entspricht.
Gerade bei großen Use Cases gilt: Zuerst die Vision skizzieren, dann in kleinere umsetzbare Teilschritte zerlegen. Diese Denkweise vermeidet Überforderung – und fördert realisierbare Fortschritte.
- Drei-Stufen-Prozess zur Ausarbeitung
Die in die engere Auswahl genommenen Anwendungsfälle werden in einem dreistufigen Prozess ausgearbeitet:
- Beschreibung im Canvas-Format: Klare Definition von Ziel, Beteiligten, Ausgangslage, Aufwand, Nutzen und Zeithorizont.
- Reflexion & Optimierung: Durch Beteiligung mehrerer Stakeholder wird jeder Anwendungsfall geschärft und erweitert – unter anderem durch Hausaufgaben, technologische Optionen oder ergänzende Perspektiven.
- Bewertung: Die Cases werden nach gemeinsam festgelegten Kriterien aus dem Innovationsrahmen bewertet. Das erzeugt Konsens und nachvollziehbare Entscheidungen.
Diese Methode fördert nicht nur Qualität und Relevanz, sondern sorgt auch für interne Akzeptanz: Der Anwendungsfall wird zum gemeinsamen Projekt.
- Business Case zur Entscheidungsvorlage
Für besonders umfangreiche oder investitionsintensive Use Cases kommt ein strukturierter Mini Business Case zum Einsatz. Er enthält unter anderem:
- Beschreibung der Ausgangssituation
- Nutzenargumentation anhand der vier Nutzenvariablen
- Detailliertes Lösungsbild inkl. KI-Elemente
- Aufwand, Zeitrahmen und Herausforderungen
- Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Organisation und Kunden
- Investitionsrahmen, ROI und Risiken
Dieses Dokument bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen – vor allem in größeren Organisationen mit komplexen Entscheidungsstrukturen.
- Framing und Verbindlichkeit im Realbetrieb
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das Framing des Projektrahmens: Alle Beteiligten müssen von Beginn an verbindlich eingebunden sein. Fehlende Teilnahme oder absinkendes Commitment gefährden sonst den Prozess.
Klar definierte Spielregeln, eine offene Kommunikation über Konsequenzen sowie ein konsequentes Vorgehen bei Abweichungen sind notwendig – insbesondere, wenn es um Projekte mit mehreren Stakeholdern und Entscheidungsebenen geht.
- Verknüpfung mit dem AI Design Sprint
Der Mini Business Case kann als Anschlussmodul an einen AI Design Sprint dienen. Besonders wenn sich im Sprint erste Use Cases als vielversprechend herausstellen, kann die vertiefende Ausarbeitung im Business Case-Format eine belastbare Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung schaffen.
Fazit
Dieser Trainingscall vermittelt praxisnah und methodisch klar, wie aus einer Vielzahl von KI-Anwendungsfällen die erfolgversprechendsten selektiert, ausgearbeitet und entscheidungsreif vorbereitet werden. Dabei werden sowohl die Perspektive des Kunden als auch die internen Strukturen berücksichtigt.
Die vorgestellten Methoden ermöglichen es, Begeisterung für KI-Innovationen in tragfähige und messbare Umsetzung zu überführen – von der Idee bis zum Business Case.
Customer Journey – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 15.05.2025
Customer Journey – Drei Perspektiven für wirksame Anwendungsfälle
Ziel des Calls
Der Schwerpunkt des Trainings lag auf der tiefgehenden Auseinandersetzung mit dem Instrument Customer Journey. Es wurde praxisnah aufgezeigt, wie sich über unterschiedliche Perspektiven gezielt Anwendungsfälle identifizieren lassen – insbesondere im Kontext von Prozessoptimierung, Produktreflexion und Kundenerlebnis. Diese Customer Journeys bilden die Basis für die Arbeit mit KI-Anwendungen im Beratungsumfeld.
Drei Perspektiven zur Analyse und Ableitung
- Prozessorientierte Perspektive
- Darstellung des Prozesses über Swimlanes oder Ablaufdiagramme.
- Reflexion entlang von Leitfragen: Was läuft gut? Wo sind Herausforderungen?
- Methoden wie SWOT-Analysen oder strukturierte Bewertung mit Post-its ermöglichen eine differenzierte Betrachtung.
- Ziel: Entwicklung konkreter Anwendungsfälle für die KI-gestützte Weiterverarbeitung.
- Produktsicht: Leuchtturmprodukt analysieren
- Nutzung eines strukturierten Canvas zur Reflexion des eigenen Produkts oder einer Dienstleistung.
- Betrachtung von Stärken, Schwächen, Potenzialen und Herausforderungen.
- Die Methodenkompetenz (z. B. SWOT) kann flexibel ergänzt werden.
- Ziel: Veränderungsnotwendigkeiten identifizieren und systematisch Verbesserungen gestalten.
- Kundenerlebnis: Customer Journey als zentrales Element
- Betrachtung der vollständigen Erlebnisreise eines Kunden über verschiedene Touchpoints hinweg:
Vom Erstkontakt über Marketing und Vertrieb bis hin zur Leistungserbringung. - Jedes Erlebnis wird hinsichtlich seiner Wirkung (positiv/negativ) bewertet.
- Ergänzt wird dies durch Betrachtung von:
- Intention: Was will der Kunde an diesem Punkt?
- Interaktion: Was passiert in der Schnittstelle mit dem Unternehmen?
- Emotion: Wie fühlt sich der Kunde – und warum?
- Praktisches Beispiel: Eine Bahnfahrt diente zur plastischen Veranschaulichung einer Customer Journey – mit allen Höhen und Tiefen.
Zentrale Erkenntnisse aus der Diskussion
- Unterschiedliche Flughöhen der Betrachtung ermöglichen differenzierte Analyse:
- Überblicksebene (z. B. vom Erstkontakt bis zur Beendigung einer Kundenbeziehung).
- Detailtiefe (z. B. eine einzelne Phase wie Onboarding oder Support).
- Diese Flughöhe ist entscheidend, um sowohl strategisch als auch operativ Wirkung zu erzielen.
- Viele Unternehmen haben ihre Customer Journey noch nie systematisch dokumentiert – hier liegt ein großes Potenzial.
Anwendung in der Praxis: Fallarbeit mit einem Kunden (MIB)
- Ziel war die strukturierte Ableitung einer realen Customer Journey aus den Transkripten zweier Kundengespräche.
- Die erste vollständige Journey: Erstellung der Wesentlichkeitsanalyse im Onboarding-Prozess.
- Anschließend wurde ein Zoom-In vorgenommen, um eine Teilphase detaillierter zu analysieren:
- Konsolidierung und Plausibilitätsprüfung von Fragebögen.
- Weitere potenzielle Journey: Wie wirken die Analyseergebnisse beim Kunden?
- Integration in Strategieprozesse.
- Nutzung der Ergebnisse für Folgeprojekte oder Wiederverwendung.
Eingesetzte Methoden und Impulse
- Kano-Modell: Unterscheidung von Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmalen.
- SERVQUAL-Modell: Bewertung immaterieller Servicequalitäten.
- Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie: Differenzierung zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit.
- Diese Modelle wurden genutzt, um die emotionale Qualität einzelner Touchpoints greifbar zu machen.
Empfehlungen und nächste Schritte
- Fokus auf die entscheidenden Customer Journeys, allen voran das Onboarding:
- Diese Phase entscheidet maßgeblich über die Dauer und Qualität der Kundenbeziehung.
- Systematische Reflexion: Welche Fragen fehlen noch, um Journeys vollständig zu dokumentieren?
- KI kann die strukturelle Aufbereitung, Analyse und Visualisierung stark beschleunigen – ersetzt aber nicht die menschliche Bewertungskompetenz.
Produktmodellierung – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 13.05.2025
Produktmodellierung, Reflexion und KI-gestützte Anwendungsfallentwicklung
- Rückblick und Einstieg
Der Call startet mit einer kurzen Wiederholung der bisherigen Arbeit: Analyse und Reflexion von Prozessen im Swimlane-Modell. Dabei ging es darum, sowohl funktionierende Elemente als auch Schwachstellen zu identifizieren – stets mit dem Ziel, daraus konkrete Anwendungsfälle abzuleiten. Dieser methodische Ansatz wird nun auf Produkte und Dienstleistungen übertragen.
- Einführung des Produktsteckbriefs
Zentrales Werkzeug des Abends ist der sogenannte Produktsteckbrief. Er dient der strukturierten Beschreibung von Produkten oder Dienstleistungen und beinhaltet unter anderem folgende Bestandteile:
- Produktname, Preisstruktur, Zielgruppe
- Problemlösung, Nutzen, Ergebnis, Einzigartigkeit
- Werteversprechen in einem Satz
- Einwertung nach standardisierter Skala (1–10) zu:
- Kompetenz-Fit
- Einkommenspotenzial
- Kundennutzen
- Visionseinzahlung
- Alleinstellungsmerkmal
- Wettbewerbsdruck
- Skalierbarkeit
- Initialisierungsaufwand
Diese Einwertungen werden mit Begründungen versehen, um fundierte Entscheidungen über die strategische Relevanz eines Angebots zu ermöglichen.
- Reflexionsmethoden im Überblick
Die Teilnehmenden lernen zwei Reflexionsarten kennen:
- Grundsätzliche Reflexion: Erste Eindrücke beim Blick auf den Steckbrief. Diese kann visuell unterstützt werden (Post-its, Ausdrucke, Pinnwände) und bietet Raum für spontane Wahrnehmungen und Diskussion.
- Methodische Reflexion: Strukturierte Betrachtung entlang eines festgelegten Modells. Ziel ist, Perspektiven zu setzen und gezielt zu diskutieren, etwa zur Frage: Was ist besonders herausfordernd bei der Herstellung oder Lieferung des Produktes?
Beide Reflexionsarten führen zu Erkenntnissen und Schlussfolgerungen, aus denen entweder Maßnahmen oder konkrete Anwendungsfälle abgeleitet werden.
- SWOT- und TOWS-Analyse
Zur Vertiefung wird die SWOT-Analyse eingeführt (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken). In einem weiteren Schritt folgt die TOWS-Matrix, welche gezielt Ableitungen trifft, zum Beispiel:
- Wie lassen sich Stärken nutzen, um Chancen zu realisieren?
- Welche Schwächen müssen eliminiert werden, um Risiken zu minimieren?
Diese Analyse erhöht die strategische Relevanz und Umsetzungsfähigkeit der Produktidee.
- Entwicklung von Anwendungsfällen
Kernziel der Reflexion ist die Identifikation konkreter Anwendungsfälle. Hierbei kommt die KI ins Spiel. Aus Interviews, Gesprächsnotizen oder Dokumenten wird automatisiert ein Produktsteckbrief erzeugt. Die daraus entstehenden Anwendungsfälle werden strukturiert formuliert, zum Beispiel nach dem Muster:
- Ich will … damit …
Die KI liefert dabei unterstützend strukturierte Vorschläge auf Basis bereits bekannter Formate und Zielsetzungen, inklusive Bezug auf vorher definierte Innovationsleitplanken.
- Drei-Prompt-Methode zur Automatisierung
Im Call wird demonstriert, wie mit nur drei gezielten Prompts ein vollständiger, fundierter Produktsteckbrief samt Bewertung erzeugt werden kann:
- Erstellung der Struktur des Produktsteckbriefs
- Analyse eines Gesprächstranskripts zur Extraktion des Produktkerns
- Übertragung der Inhalte in das Steckbrief-Template inklusive Einwertungen
Damit lässt sich ein Beratungsprodukt wie die Wesentlichkeitsanalyse strukturiert abbilden und mit relevanten Metriken versehen.
- Prozessautomatisierung mit Custom GPTs
Im Anschluss wird skizziert, wie dieser gesamte Prozess weiter skaliert und automatisiert werden kann. Durch Kombination von Custom GPTs, Agenten und Automatisierungsplattformen wie Make oder Power Automate kann ein Interview automatisiert in strukturierte Berichte, Steckbriefe oder Handlungsempfehlungen überführt werden.
Das Ziel: Mehr Effizienz, weniger Ressourcenverbrauch beim Kunden und ein klares, vermarktbares Produkt.
- Praxisbeispiele und Learnings
Die Teilnehmenden teilen eigene Erfahrungen, unter anderem mit:
- Einsatz von KI zur Vorbereitung von Kundengesprächen (z. B. durch Analyse von LinkedIn-Profilen)
- Umgang mit technischen Grenzen von Modellen (Token-Limits, Dateigrößen)
- Gestaltung effektiver Prompts zur Steuerung der Ergebnisqualität
Zum Abschluss wird nochmals deutlich: Wer die Logik hinter der KI versteht und sie mit Methodik kombiniert, verschafft sich einen echten strategischen Vorsprung.
Fazit
Die systematische Betrachtung und Reflexion von Produkten lässt sich effektiv mit KI unterstützen. Durch ein strukturiertes Vorgehen – von der Produktdefinition über SWOT/TOWS-Analyse bis hin zur Identifikation von Anwendungsfällen – entsteht ein fundiertes Verständnis, das sowohl in Beratungsprozessen als auch in der Produktentwicklung unmittelbaren Mehrwert stiftet.
Von der Perspektive zur Prozessoptimierung – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 08.05.2025
Von der Perspektive zur Prozessoptimierung mit KI
In diesem Training wurde vertieft, wie aus individuellen und organisatorischen Perspektiven konkrete, wirksame Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz entwickelt werden können. Im Fokus stand insbesondere das strukturierte Vorgehen zur Identifikation und Optimierung von Prozessen – als Hebel zur Einführung und Integration von KI.
Rückblick und Ausgangspunkt
Der Call knüpft an die vorherige Session an, in der die Teilnehmenden mit einem 6-Fragen-Modell ihre eigene Selbstständigkeit analysiert und erste KI-Anwendungsfälle identifiziert haben. Auf Basis dieser individuellen Reflexion wurde nun der Transfer in organisatorische Kontexte vorbereitet.
Perspektivenwechsel: Vom Individuum zur Organisation
Teilnehmende wurden befähigt, die Methodik aus dem Dienstagstraining selbstständig auf Teams oder Abteilungen zu übertragen. Ziel ist es, KI-Workshops im Unternehmen zu moderieren und so Mitarbeitende zu begleiten – von der Perspektivarbeit über die Anwendungsfallfindung bis hin zur Umsetzung.
Vier grundlegende Betrachtungsebenen für KI-Anwendungsfälle
- Produkte und Dienstleistungen: Wie kann ein Produkt durch KI verbessert, ergänzt oder effizienter hergestellt werden?
- Kundenerlebnisse (Customer Journey): Analyse der Kundenreise zur Identifikation von Reibungspunkten und Innovationschancen.
- Das 6-Fragen-Modell: Einsetzbar auf individueller wie auf organisationaler Ebene.
- Prozesse: Im Zentrum der heutigen Arbeit – mit Fokus auf modellierter Struktur und operativer Umsetzung.
Strukturierte Prozessanalyse in vier Schritten
- Perspektive einnehmen
- Klärung der Prozess-Ebene: Prozesssteckbrief (Level 3), konkreter Prozessablauf (Level 4), Arbeitsanweisung/SOP (Level 5).
- Identifikation relevanter Teilprozesse oder Subsysteme.
- Modellierungsstatus klären
- Ist der Prozess dokumentiert? In welcher Form? (z. B. Swimlane, Ablaufdiagramm, SOP)
- Falls nein: Dokumentation gemeinsam erarbeiten.
- Schwachstellen- und Stärkenanalyse
- Für jeden Schritt analysieren: Was läuft gut? Was läuft schlecht? Was sollte unverändert bleiben?
- Ziel ist es, Schwachstellen zu eliminieren, delegieren oder automatisieren – und Stärken gezielt zu fördern.
- Anwendungsfälle entwickeln
- Brainstorming auf Basis der Analyse.
- Erste Setbildung von potenziellen KI-Einsatzszenarien.
- Später erfolgt Bewertung hinsichtlich Aufwand und Nutzen.
Beispiel: LinkedIn-Prozess
Anhand eines vereinfachten Social-Media-Prozesses wurde exemplarisch gezeigt, wie Schwachstellen (z. B. Abhängigkeit von Einzelpersonen) identifiziert und durch KI-gestützte Lösungen wie Texterstellung oder Prozessautomatisierung optimiert werden können.
Vertiefung: Prozessphasen strategisch betrachten
Zusätzliche Perspektive auf Prozessebene:
- Entscheidungspunkte mit menschlicher Verantwortung erkennen.
- Teilbereiche mit KI-Unterstützung oder vollständiger Automatisierbarkeit identifizieren.
- Ermittlung von Phasen, die Spezialtools erfordern.
- Vorbereitende Aufgaben („Hausaufgaben“) sicherstellen, z. B. Datenqualität, Informationslage.
Praxisfall Autohaus-Vertrieb
Am Beispiel eines Autohauses wurden typische Verkaufsphasen durchgespielt – von der Bedarfsermittlung bis zur Fahrzeugübergabe.
Innerhalb der Phase „Bedarfsermittlung“ wurden exemplarisch Unterphasen (z. B. Begrüßung, Fragen, Terminvereinbarung) analysiert.
Ziel: Konkrete Schwächen und Optimierungspotenziale auf subprozessualer Ebene sichtbar machen.
Fazit
Das Training vermittelt praxisnah, wie aus einer Perspektivarbeit strukturierte Prozessanalysen entstehen, aus denen wiederum fundierte KI-Anwendungsfälle abgeleitet werden können. Entscheidend ist eine saubere Modellierungsbasis, eine klare Zieldefinition – und die Bereitschaft, auch technische und organisatorische „Hausaufgaben“ zu erledigen, bevor KI gewinnbringend zum Einsatz kommen kann.
Von der Perspektive / Rolle zu Anwendungsfällen durch 6 Fragen – Taktische Ebene – Aufzeichnung – 06.05.2025
DOWNLOADS
Zusammenfassung:
- Einführung und Arbeitsweise
- Zwei Wege zur Teilnahme: Entweder mit dem Workbook auf dem iPad oder mit Papier und Stift. Ausdrucke sind nicht zwingend notwendig.
- Die Übung wird schrittweise begleitet, mit regelmäßigen Reflexionsphasen (alle ca. 10 Minuten), wie in einem Live-Workshop.
- Ziel ist es, gemeinsam durch einen strukturierten Denk- und Reflexionsprozess zu gehen.
- Klärung der Rolle & Perspektive
- Teilnehmer sollen eine feste Rolle/Perspektive wählen, aus der heraus sie alle weiteren Fragen beantworten. Diese Klarheit verhindert Reibungsverluste im Denken.
- Typische Rollenbeispiele: Rezeption, Assistenz, Vertrieb, Auszubildender etc.
- Wichtigkeit der Perspektive: Nur durch einen konsistenten Blickwinkel wird der Prozess erlebbar und später reproduzierbar – auch im Kundensetting.
- Der methodische Prozess – Übersicht
Es wurden sechs zentrale Fragen bearbeitet, die zur Identifikation und Priorisierung von Anwendungsfällen führen:
- Was ist deine Rolle? – Wer bist du, wem hilfst du, welches Problem löst du?
- Welche laufenden Projekte bearbeitest du aktuell?
- Welche wiederkehrenden Aufgaben beschäftigen dich regelmäßig?
- Was sind Aufgaben, die du gerne eliminieren würdest (Kleinscheiß)?
- Welche Aufgaben willst du automatisieren oder beschleunigen?
- Wo wünschst du dir mehr Wirkung/Sichtbarkeit?
- Anwendungsfälle formulieren („Ich will … damit …“)
- Aus den oben genannten Fragen werden konkrete Anwendungsfälle in einem einheitlichen Format abgeleitet:
- Beispiel: „Ich will meine Social-Media-Kommunikation automatisieren, damit ich mehr Zeit für meine Kunden habe.“
- Diese Kurzform dient als Vorstufe zur weiteren strategischen Ausarbeitung.
- Einordnung nach Aufwand & Nutzen
- Jeder identifizierte Anwendungsfall wird subjektiv auf einer Matrix eingeordnet:
- Achsen: hoher/niedriger Aufwand vs. hoher/niedriger Nutzen
- Ziel: Fokus auf Quick Wins (hoher Nutzen, geringer Aufwand) und sinnvolle Investments (hoher Aufwand, hoher Nutzen)
- „Streichkandidaten“: hoher Aufwand, geringer Nutzen
- Fallbeispiele aus der Praxis
Einzelne Teilnehmer teilen ihre Anwendungsfälle – exemplarisch einige Highlights:
- Christian:
- „Ich will den Kleinscheiß vom Tisch bekommen, damit ich mich auf strategischere Aufgaben konzentrieren kann.“
- Martin:
- „Ich will eine Keynote entwickeln, um über LinkedIn konkretere Anfragen zu generieren.“
- Frank:
- „Ich will regelmäßiger auf LinkedIn posten und kommentieren, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen.“
- Matthias:
- „Ich will mein technisches Setup optimieren, um professioneller aufzutreten.“
- Moderationstipps & Benchmark setzen
- Strategische Auswahl der ersten Redner: Bewusst Teilnehmer mit klarem Output zuerst sprechen lassen, um das Benchmark für die Gruppe hochzusetzen.
- Ziel: Hohe Qualität in den Anwendungsfällen etablieren, damit der Workshop auf einem starken Niveau startet.
- Erweiterung für Angestellte – Rollen-Klarheit
- Marc & Christian diskutieren ein Modell zur Rollenschärfung im Angestelltenkontext:
- Was ist deine Aufgabe?
- Welche Verantwortung trägst du?
- Welche Rolle ergibt sich daraus?
- Diese Klarheit ist oft nicht gegeben – bietet enormes Potenzial für Coaching & Beratung.
- Ausblick auf kommende Sessions & Hausaufgaben
- Nächste Schritte: Ausarbeitung einer „Shortlist“ an Anwendungsfällen zur detaillierten Umsetzung.
- Hinweis auf das KI-Connect Event im Juli.
- Samstags-Workshop (nur online): Fokus auf technische Basics wie z.B. LinkedIn-Analyse über ChatGPT, Erstellung von Action-Figuren, etc.
- Vorbereitung: Videos mit Erklärungen zum Vorab-Training folgen.
- Hinweise für Donnerstag
- Themenfokus: Prozess-Modellierung.
- Beispiel: Wie entsteht bei euch eine Wesentlichkeitsanalyse? (Prozessaufnahme zur späteren Optimierung mit KI).
Fazit
In dieser Session wurden die Grundlagen für das Identifizieren, Formulieren und Priorisieren von KI-Anwendungsfällen gelegt. Die Teilnehmer haben gelernt, aus einer klar definierten Perspektive heraus zu denken und konkrete Schritte zu definieren, um mit Hilfe von KI echte Wirkung im eigenen Business oder im Unternehmenskontext zu erzielen. Der methodische Rahmen bietet eine starke Grundlage für weitere strategische und operative Entwicklungen.
Überblick über die taktische Ebene – Aufzeichnung – 29.04.2025
Ziel und Kontext des Calls
Dieser Call markiert den Übergang von der strategischen in die taktische Ebene innerhalb der KI-Strategieberater-Ausbildung. Ziel ist es, Anwendungsfälle zu identifizieren, zu priorisieren und aufzubereiten – als Brücke zur operativen Umsetzung mit oder ohne KI.
Rückblick auf bisherige Inhalte
- Sensibilisierung und Einführung in zentrale Konzepte wie:
- Rahmenfrage
- Potenzialanalyse
- Reifegradmodell
- Erarbeitung der strategischen Ebene:
- Bestehendes Geschäftsmodell reflektiert
- Strategy-on-a-Page analysiert
- SWOT-Analyse mit Wechselwirkungen
- Trend- und Triggerkarten als Einflussfaktoren
- Entwicklung eines Zukunftsbildes
Kerninhalte der taktischen Ebene
- Ziel der taktischen Ebene
- Anwendungsfälle identifizieren, die entweder auf einem bestehenden oder einem neuen Geschäftsmodell/Strategie basieren.
- Fokussiert auf konkrete, umsetzbare Use Cases.
- Quellen zur Identifikation von Anwendungsfällen
Es wurden verschiedene interne und externe Quellen für Anwendungsfälle diskutiert:
Interne Quellen:
- Teams und Mitarbeitende
- Geschäftsführung, Führungskräfte, operative Rollen
- Bestehende Prozesse und wiederkehrende Routinen
- Perspektiven aus verschiedenen Rollen
Externe Quellen:
- Regulatorik
- Best Practices und Expertenwissen
- Wettbewerbsanalysen
- Kundenfeedback und Kundenerwartungen
Weitere Impulse:
- SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken)
- Trendanalyse und externe Einflussfaktoren
- Pain Points und Leidensdruck im Markt
- Perspektiven zur Betrachtung von Anwendungsfällen
Um Anwendungsfälle zu identifizieren, können verschiedene Perspektiven eingenommen werden:
- Prozesse: Kernprozesse wie Marketing, Vertrieb, Produktion sowie unterstützende Prozesse wie IT, Finance, HR, etc.
- Produkte & Dienstleistungen: Betrachtung des aktuellen Leistungsangebots hinsichtlich Optimierungspotenzial und Innovation
- Customer Experience / Customer Journey: Wie erleben Kunden die Leistungserbringung? Welche Emotionen, Hürden oder Potenziale ergeben sich?
Besonderer Fokus auf Customer Journey als unterschätzte, aber hochwirksame Perspektive, inspiriert durch Best Practices von Disney, Apple und Ritz-Carlton.
- Praktischer Einstieg: Das 6-Fragen-Modell
Ein niedrigschwelliger Einstieg zur Anwendungsfall-Identifikation erfolgt über sechs einfache Fragen aus der eigenen Rolle heraus:
- Welche Projekte laufen aktuell?
- Welche wiederkehrenden Aufgaben oder Routinen gibt es?
- Welche Chancen und Herausforderungen sind relevant?
- Welche Risiken gilt es zu adressieren?
- Welche Zeitfresser bestehen?
- Welche persönlichen Unzulänglichkeiten oder Schwächen stehen im Weg?
Ziel: Niedrigschwelliger Einstiegspunkt, um mit Kunden oder Teams erste Use Cases zu entwickeln.
- Systematische Priorisierung und Bewertung
- Bewertung von Anwendungsfällen anhand von Aufwand und Nutzen
- Aufbrechen großer Use Cases in kleinere, machbare Teilprojekte
- Schaffung von Entscheidungsgrundlagen für Investitionen und Umsetzung
Wichtige Methoden und Tools
- Reflexion auf Basis von Perspektiven und Rollen
- Einsatz von Trend- und Triggerkarten
- Nutzen-/Aufwand-Matrix zur Bewertung
- Entwicklung kleiner Use Cases für Entscheidungsgremien (Mini Business Cases)
- Einbindung in den Innovationsrahmen
Ausblick auf die kommenden Wochen
Die nächsten Wochen stehen im Zeichen der Vertiefung:
- Dienstag (nächster Call): Anwendung des 6-Fragen-Modells aus der eigenen Rolle heraus
- Weitere Sessions:
- Prozessorientierte Betrachtung (inkl. Wesentlichkeitsanalyse)
- Betrachtung von Produkt & Dienstleistung
- Customer Journey Analyse
- Zuordnung von KI-Potenzialen
- Ausformulierung konkreter Anwendungsfälle
- Vorbereitung auf Entscheidungsvorlagen
Auch rechtliche Aspekte (z. B. mit Prof. Philipp Hacker) und Datenschutz werden thematisiert.
Fazit
Die taktische Ebene bildet das Herzstück für die praktische Arbeit der KI-Strategieberater: Sie verbindet die strategische Vision mit konkreten Umsetzungsschritten. Durch fundierte Analyse, Perspektivenvielfalt und strukturierte Methoden wie das 6-Fragen-Modell entstehen belastbare Anwendungsfälle, die entweder direkt umgesetzt oder für spätere Entscheidungen vorbereitet werden können.